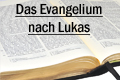Einleitung
Das Lukasevangelium stellt den Herrn Jesus Christus als den Sohn des Menschen dar, der in himmlischer Gnade unter den Menschen wirkt. Es ist eines der drei sogenannten „synoptischen“ Evangelien – Matthäus und Markus sind die beiden anderen. Sie werden so genannt, weil sie einen einfachen Überblick oder eine Zusammenfassung des Dienstes des Herrn geben, während das Johannesevangelium dies nicht tut. Abgesehen von den Kapiteln zwei, vier und sechs konzentriert sich Johannes ausschließlich auf die Ereignisse im Leben und Wirken des Herrn in Jerusalem.
Was das Lukasevangelium kennzeichnet, ist nicht die offizielle Herrlichkeit des Herrn als der Messias und der König Israels, wie ihn Matthäus in seinem Evangelium darstellt. Es stellt uns auch nicht – so wie Markus – die Herrlichkeit des Herrn als großer Prophet beziehungsweise Knecht vor Augen, den Gott in die Welt zu senden verheißen hatte. Ebenso wenig betont es die Eigenschaften der göttlichen Natur in Christus, dem Sohn Gottes, wie das Johannesevangelium. Es stellt uns vielmehr die moralische Herrlichkeit des Herrn als Sohn des Menschen vor Augen, das heißt die moralische Vollkommenheit seines Wandels und seiner Wege als Mensch.
Während Matthäus eine dispensationale Ordnung und Markus eine chronologische Ordnung hat, folgt Lukas einer moralischen Ordnung. Auch wenn es nicht immer so aussieht, schreibt er „der Reihe nach“ (Lk 1,3), indem er oft Dinge aus ihrer historischen Abfolge herausnimmt und sie in einer moralischen Ordnung zusammenfasst. Er tut dies, um uns bestimmte praktische Lehren aus dem Leben und Dienst des Herrn zu vermitteln.
Der Verfasser – Lukas
Lukas, „der geliebte Arzt“, wie ihn der Apostel Paulus nennt (Kol 4,14), ist der göttlich inspirierte Verfasser dieses Evangeliums. Er ist der einzige nichtjüdische Verfasser der Bibel. Das geht aus seinem Namen hervor, der griechischen Ursprungs ist, und auch aus der Art und Weise, wie der Apostel Paulus in Kolosser 4 von ihm spricht. Indem Paulus die Grüße seiner Mitarbeiter an die Gläubigen in Kolossä weiterleitet, spricht er von zwei Gruppen von Gläubigen: von denen, die aus der Beschneidung (Juden) gerettet wurden, und von denen, die nicht aus der Beschneidung (Heiden) gerettet wurden (vgl. Eph 2,11). Er zählte Lukas zur zweiten Gruppe.
Lukas steuert zwei lange Bücher zum Kanon der Heiligen Schrift bei: das Lukasevangelium und die Apostelgeschichte. Diese beiden Bücher machen mehr als dreißig Prozent des Neuen Testamentes aus. Es ist nicht genau bekannt, wann Lukas diesen „Bericht“ (Apg 1,1) schrieb, aber als Paulus seinen ersten Timotheusbrief schrieb, bezeichnete er den Bericht des Lukas als Heilige Schrift und zitierte daraus (Lk 10,7; 1Tim 5,18). Wir wissen nur, dass Lukas das Evangelium schrieb, bevor er die Apostelgeschichte verfasste (Apg 1,1).
Obwohl Lukas sehr gebildet (er war Arzt) und kultiviert war (er war ein Freund von Theophilus, einem Mann von hohem gesellschaftlichen Rang), war er ein wahrhaft demütiger Diener des Herrn. Er war ein so bescheidener Mann, dass er bei der Aufzeichnung der Ereignisse in der Apostelgeschichte – einem Werk, an dem er maßgeblich beteiligt war – nicht einmal seinen Namen erwähnte. Er spielt lediglich auf seine Anwesenheit zusammen mit dem Apostel Paulus an, indem er die Pronomen „wir“ und „uns“ verwendet. So war Lukas ein ideales Werkzeug für den Geist Gottes, um den Herrn Jesus in diesem Evangelium als „sanftmütig und von Herzen demütig“ darzustellen (Mt 11,29; 2Kor 10,1; Phil 2,8).
Die Zusammenarbeit zwischen Lukas und Paulus begann in Troas, wo er sich der Missionsgruppe des Paulus anschloss, zu der auch Silas und Timotheus gehörten (Apg 16,10). Die vier überquerten gemeinsam das Ägäische Meer und brachten das Evangelium zum ersten Mal nach Europa. Als in Philippi einige gerettet wurden, blieb Lukas bei ihnen zurück, um die neue Gemeinde dort zu gründen und zu hüten, während Paulus und die anderen weiterzogen (Apg 17,1: „sie“). Lukas und Paulus wurden dann für einige Zeit getrennt, fanden aber in Philippi wieder zueinander, woraufhin Lukas Paulus nach Jerusalem begleitete, wo Paulus in Gefangenschaft geriet (Apg 20,6). Nachdem Paulus zwei Jahre lang in Cäsarea gefangen gehalten worden war, begleitete Lukas ihn auf seiner Reise nach Rom, die mit einem Schiffbruch endete (Apg 27). Nach zwei weiteren Jahren der Gefangenschaft in Rom (Apg 28,30) wurde Paulus freigelassen und später ein zweites Mal gefangen genommen. Während andere den Apostel in seiner zweiten Gefangenschaft im Stich ließen, blieb Lukas ihm treu und blieb bis zum Ende bei ihm (2Tim 4,11).
Der nichtjüdische Charakter des Buches
Lukas hatte sich als Nichtjude aus den heidnischen Nationen bekehrt und schrieb an einen bekehrten Nichtjuden (Theophilus). Aufgrund seiner Herkunft hatte er ein natürliches Interesse an seinen nichtjüdischen Mitmenschen und schrieb unter der Führung des Heiligen Geistes mit Blick auf sie. Das Buch hat daher einen nichtjüdischen Charakter. Indem Paulus das Leben und den Dienst des Herrn nachzeichnet, spielt er des Öfteren darauf an, dass Gottes Gnade in Christus über die Grenzen Israels hinausgehen und der heidnischen Welt Segen bringen würde. Damit zeigt er, dass die Gnade Gottes einfach zu groß ist, um sich auf ein bestimmtes Volk zu beschränken, sondern dass sie alle Völker erreichen wird. Der Herr Jesus war ausschließlich „ein Diener der Beschneidung“ (Röm 15,8) und ging daher in seinem Dienst nicht persönlich zu den Heiden (Mt 15,24). Es gibt jedoch im gesamten Evangelium Hinweise, die darauf schließen lassen, dass Gott, nachdem Christus durch seinen Tod Sühnung getan hatte und der Heilige Geist herabgesandt worden war, die Heiden erreichen würde, um sie zu segnen (Apg 13,46-49; 15,14; 18,6; 28,28).
Der nichtjüdische Charakter des Buches zeigt sich darin, dass Lukas aus der Septuaginta, einer griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, zitiert. Tatsächlich sagt dieses Evangelium wenig darüber, dass sich durch den Herrn Jesus alttestamentliche Prophezeiungen erfüllt hätten, denn die Heiden hätten im Allgemeinen diese Prophezeiungen nicht gekannt, weil ihnen die Schrift nicht ausdrücklich gegeben worden war (Röm 3,1-2; Eph 2,11-12). Dies zeigt sich auch daran, dass Lukas sich die Zeit nimmt, seinen Leser (Theophilus) über die Lage bestimmter jüdischer Orte zu informieren, was für Juden, die mit diesen Orten im Land vertraut waren, nicht notwendig gewesen wäre (Lk 1,26; 4,31; 8,26; 21,37; 23,51; 24,13 usw.).
Lukas ist tatsächlich der einzige Evangelist, der Daten in seine Erzählung aufnimmt, die es uns ermöglichen, die heilige Geschichte mit der weltlichen Geschichte zu verbinden (Lk 1,5; 2,1-2; 3,1). Das ist etwas, das für Heiden von Bedeutung sein könnte, die eher die Weltgeschichte als die jüdische Geschichte kennen. Auch das Erscheinen des Engels Gabriel in der Erzählung (Lk 1,19.26) weist auf heidnische Dinge hin, denn er wird im Buch Daniel im Zusammenhang mit den Zeiten der Nationen erwähnt (Dan 8,16; 9,21). Außerdem führt Lukas den Stammbaum des Herrn zurück bis zu Adam, dem Stammvater der gesamten Menschheit (Lk 3,23-38), und nicht bis zu Abraham wie Matthäus in seinem Evangelium (Mt 1,1-17). Daraus ergibt sich, dass Christus, der Retter der Welt, für das Heil der ganzen Welt gekommen ist, nicht nur für Abrahams Nachkommenschaft.
So stellt Lukas die frohe Botschaft von Christus als eine Botschaft dar, die für das Wohlergehen und die Erlösung des gesamten Menschengeschlechts entscheidend ist. Das macht sein Evangelium ideal für die Mission unter den Heiden.
Einige herausragende Merkmale im Lukasevangelium
Indem das Lukasevangelium den Herrn Jesus Christus als den vollkommenen Menschen unter den Menschen darstellt, vermittelt es die gute Nachricht in ganz gewöhnlichen Lebensumständen. Es enthält eine Reihe von häuslichen Tischszenen, in denen der Herr die Wahrheit in Gesprächen lehrt und illustriert. Daher wird es auch das „soziale“ Evangelium genannt. Diese wirklichkeitsnahen Szenen aus dem Alltagsleben geben uns Einblicke in das Leben des sanftmütigen und bescheidenen Erlösers, dessen Wege von Mitgefühl, Liebe und Anteilnahme erfüllt waren. Solche Szenen zeigen dem Leser eine Seite des Herrn Jesus, die sehr anziehend ist.
Frauen kommen in diesem Evangelium häufiger vor als in jedem anderen. Witwen werden besonders hervorgehoben. Man sieht sie, wie sie Offenbarungen empfangen, prophezeien, Lobgesänge anstimmen usw. Vielleicht soll damit die moralische Seite der Wahrheit hervorgehoben werden, zu der Frauen von Natur aus neigen.
Dieses Evangelium spricht besonders die Armen an, die mit den Erprobungen ihrer sozialen Stellung im Leben zu kämpfen haben. Viele der Lektionen basieren auf diesem gemeinsamen Kampf und vermitteln allen, die ebenfalls in so einer Lage sind, Hoffnung und Ermutigung. Gleichzeitig warnt es vor den Gefahren des Reichtums. So erwähnt es viele reiche Männer; aus diesen Berichten können wichtige moralische Lehren abgeleitet werden, die für alle gelten, nicht nur für die Reichen.
Dieses Evangelium ist auch durch zahlreiche Verweise auf den Himmel gekennzeichnet – vor allem in der zweiten Hälfte des Buches –, die den Übergang von der Erde zum Himmel verdeutlichen, der mit der Einführung des Christentums einherging. In diesem Zusammenhang ist das Wirken des Lukas eine Vorbereitung auf das Wirken des Paulus, in dem ein offener Himmel und ein verherrlichter Mensch zu sehen sind, der dort sitzt.
Das Gebet wird in diesem Evangelium mehrfach erwähnt und als die richtige Haltung des Menschen dargestellt, der ein abhängiges Geschöpf in Gottes Schöpfung ist (Lk 1,10.13 usw.). Das Gebet wird nicht nur durchgehend gelehrt und empfohlen, sondern auch im Leben des Herrn aufgezeigt. Als Mensch in seiner eigenen Schöpfung bringt der Herr auf Schritt und Tritt seine Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck, wie es jeder Mensch tun sollte. Weit über ein Dutzend Mal wendet er sich im Gebet an Gott (Lk 3,21; 5,16; 6,12; 9,16.18.28-29; 10,21; 11,1; 22,17.19.32.41; 23,34.46; 24,30.50). Wie sehr unterscheidet sich dies vom Johannesevangelium, das den Herrn als Gott „offenbart im Fleisch“ betrachtet, der alle Eigenschaften der Gottheit besitzt und somit „Gott gleich“ ist (1Tim 3,16; Joh 5,18). Indem Er betont, dass Er „Gott“ ist (Joh 1,1), betet Er im Johannesevangelium nicht – mit Ausnahme von Johannes 6,11, wo Er seinen Jüngern ein Vorbild gibt. Gebet bedeutet, dass ein Untergeordneter seine Abhängigkeit von einem Höhergestellten zum Ausdruck bringt und ihn um Hilfe und Führung bittet. Da der Herr bei Lukas als ein abhängiger Mensch dargestellt wird, ist es richtig und angemessen, dass Er betet, aber bei Johannes, wo Er als Gott dargestellt wird, hat Er keinen Höhergestellten. Er steht in ständiger Verbindung zu seinem Vater, spricht im gesamten Evangelium zu Ihm, aber das wird nicht als Gebet gesehen, sondern als Gemeinschaft zwischen göttlichen Personen. (In Johannes 17 heißt es mehrmals „bitten“, aber es sollte mit „verlangen“ übersetzt werden, denn als Gott hat Er jedes Recht, Dinge zu verlangen.)
Die moralische Schönheit in Christus, dem Sohn des Menschen
Das vielleicht herausragendste Merkmal im Lukasevangelium ist die Vollkommenheit der moralischen Wege des Herrn. Er wird auf jede nur erdenkliche Weise erprobt, wie ein gerechter Mensch geprüft und versucht werden könnte, und wird als vollkommen in all seinen Wegen gesehen.
Als Gott, der sich im Fleisch offenbart hat (1Tim 3,16), war der Herr Jesus der einzige Mensch, der das Recht hatte, sich selbst zu erhöhen; da Er aber in Menschengestalt gefunden wurde, erniedrigte Er sich selbst (Phil 2,8). Er war sanftmütig und demütig (Mt 11,29) und ging unter die Menschen ohne Pomp und Prunk (Jes 53,2). Er verbrachte seine Zeit vor allem unter denen, die aus den einfachsten Verhältnissen stammten. Er war so demütig und bescheiden, dass eine Frau sich nichts dabei dachte, Ihn zu unterbrechen, während Er das Wort verkündete. Er antwortete ihr gnädig und tadelte sie nicht dafür (Lk 11,27). Er war so bescheiden und unauffällig, dass Er unter den Jüngern nicht als ihr Meister auffiel. Als die Männer kamen, um Ihn zu verhaften, konnten sie Ihn unter den anderen nicht erkennen und mussten sie fragen, wer von ihnen der Anführer sei (Joh 18,3-5).
Sein ganzes Leben war geprägt von Gehorsam und Unterwerfung unter den Willen Gottes (Phil 2,8; Heb 5,8; Mt 11,25-26; 26,39). Er lebte nach jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kam (Jes 50,4-7; Mt 4,4). Er handelte nie, wenn Er nicht zuvor ein Wort von seinem Vater dazu erhalten hatte. Er tat nie etwas, um sich selbst zu gefallen (Röm 15,3), sondern Er lebte, um seinem Vater zu gefallen (Joh 8,29). Das war von morgens bis abends das Ziel seines Lebens (Joh 4,34).
Weil Gehorsam und Glück zusammengehören (Spr 29,18; Joh 13,17), war Er ein wahrhaft glücklicher Mensch. Er war ein Mensch der Freude, aber niemals leichtfertig oder albern. Seine Freude kam nicht von angenehmen Umständen (gutes Wetter usw.), sondern aus der Gemeinschaft mit seinem Vater (Joh 16,32).
Er war wirklich ein selbstloser Mensch. Er stellte die Interessen und Bedürfnisse der anderen vor seine eigenen. Er bemühte sich um das Wohl und Wohlergehen anderer und setzte Gottes Kraft frei ein, um ihre Bedürfnisse zu stillen, vollbrachte aber niemals ein Wunder für sich selbst, denn Er selbst litt Not, Hunger und Durst. Er war immer ansprechbar; sogar für Kinder hatte Er Zeit (Mt 19,13-15). Er wies keinen einzigen Menschen ab, der nach Ihm suchte (Joh 6,37). Die Vaterlosen und die Witwen fanden Erbarmen bei Ihm (Lk 7,12).
Seine Rede war voller Gnade; so sehr, dass die Menschen sich über die Worte der Gnade wunderten, die aus seinem Mund kamen (Lk 4,22). Er stritt nie und sagte nie ein Wort in einem falschem Ton (1Pet 2,22-23). Die Diener, die ausgesandt worden waren, um Ihn festzunehmen, mussten zugeben, dass sie noch nie einen Menschen so reden gehört hatten wie Ihn (Joh 7,46). Er sprach zu der Frau am Brunnen mit so wunderbarem Taktgefühl, dass Er sie von einem Leben in Sünde abbrachte (Joh 4).
Er gab nie mit seinen Fähigkeiten im Dienst an. Er hätte große Teile der Schrift wortwörtlich zitieren können, aber damit hätte Er die Aufmerksamkeit in falscher Weise auf sich gelenkt. Er benutzte das Wort Gottes nicht, um sein Wissen zu demonstrieren, sondern zitierte nur das, was in der jeweiligen Situation nötig war.
Er wehrte sich nie gegen persönliche Beleidigungen. Als seine Gegner Ihn beschimpften und sagten, Er sei ein Samariter, ließ Er es durchgehen, aber Er verteidigte die Herrlichkeit seiner Person in der Gottheit (Joh 8,48-49).
Seine Heiligkeit machte Ihn in der Welt, die Er geschaffen hatte, zu einem völlig Fremden, weil sie durch die Sünde verunreinigt war (Joh 1,10). Er war ein Mann der Schmerzen, aber niemals traurig und trübselig. Er trug die Sorgen der anderen auf dem Herzen und fühlte tief mit den Schwierigkeiten, die sie durchmachten (Jes 53,3-4; Mt 8,16-17). Als ein armer Aussätziger zu Ihm kam, wurde Er von Mitleid ergriffen, streckte seine Hand aus und berührte ihn (Mk 1,41). Es war vielleicht das erste Mal seit Jahren, dass jemand diesen Mann berührte, denn der Kontakt mit einem Aussätzigen war verboten! Er tröstete Menschen, die trauerten, als der Tod ihre Familien heimsuchte (Mk 5,35-43; Lk 7,11-15; Joh 11,17-46).
Er war treu. Er würde im Haus eines Pharisäers essen, aber nicht im Haus eines Sadduzäers, denn die Sadduzäer leugnen die Heilige Schrift und die Grundlagen des jüdischen Glaubens. Er hatte keine Gemeinschaft mit ihnen, sondern tadelte sie vielmehr wegen ihres Unglaubens (Mt 22,29).
Sein ganzes Leben lang wurde Er von dem Volk, das Er liebte und segnen wollte, abgelehnt, doch Er beklagte sich nie darüber. Oft verbrachte Er die Nächte unter freiem Himmel, ohne einen Platz zu haben, wo Er sein Haupt hinlegen konnte (Mt 8,20). Als Er Jerusalem besuchte und das Volk im Tempel lehrte, dachte niemand daran, Ihn zu sich nach Hause einzuladen. So ging Er einfach auf den Ölberg und verbrachte dort die Nacht (Joh 7,53–8,1). Er wollte sich niemand aufdrängen, der Ihn nicht wollte. Als Er mit den beiden Jüngern nach Emmaus ging, tat Er, als wolle Er weitergehen, und wartete, bis sie Ihn nötigten, in ihr Haus zu kommen (Lk 24,28).
Seine Jünger missverstanden Ihn und stellten Ihn oft falsch dar. Er korrigierte geduldig ihre Fehler und nahm ihr Versagen nie zum Anlass, sie zu demütigen. Anstatt sie mit ihren Fehlern zu beschäftigen, hob Er ihre Gedanken auf eine höhere Ebene der Gemeinschaft mit Ihm selbst. Kein Wunder, dass sie Ihn liebten!
Er veranschaulichte seine eigene Lehre auf vollkommene Weise – Gutes zu tun und zu leihen, ohne darauf zu hoffen, es wiederzubekommen (Lk 6,35). Es gab keinen einzigen Fall, in dem Er Anspruch auf die Person oder den Dienst derer erhob, die Er wiederhergestellt und befreit hatte. Er liebte, heilte und befreite viele Menschen, doch Er erwartete keine Gegenleistung, denn das Wesen der Gnade besteht darin, anderen Gutes zukommen zu lassen, und nicht darin, sich selbst zu bereichern. Bei jeder Gelegenheit zeigte Er, dass es seliger ist, zu geben als zu nehmen (Apg 20,35).
Er wollte von niemand Mitleid. In Gethsemane bat Er seine Jünger, mit Ihm zu wachen, doch nicht, für Ihn zu beten (Mt 26,40). Als seine Jünger Ihn im Garten im Stich ließen und nicht mit eine Stunde mit Ihm wachten, entschuldigte Er langmütig ihren Schlaf, indem Er sagte, dass ihr Geist zwar willig, aber das Fleisch schwach sei (Mt 26,41). Er entschuldigte ihre Schwachheit, aber nicht ihre Sünde. Auf dem Weg zum Kreuz sagte Er den Frauen, sie sollten nicht über Ihn weinen, sondern über sich selbst und ihre Kinder angesichts des Gerichts, das über die schuldige Stadt kommen würde (Lk 23,28).
Als sie Ihn kreuzigten, bat Er noch um ihren Segen und rief seinen Vater an, ihnen zu vergeben (Lk 23,34). Selbst als Er im Sterben lag, hatte Er noch Zeit für den Dieb, der am Rande der Verdammnis stand, und goss Öl und Wein aus den Vorräten Gottes ein, weil der Mann wirklich Buße tat (Lk 23,39-43).
Er war also im Leben und im Tod ein vollkommener Mensch, und Lukas hebt diese Seite der Person des Herrn hervor.
Auslegung und Anwendung des Lukasevangeliums
Da das Buch moralische und praktische Wahrheiten hervorhebt, ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Lukas bei der Darstellung der guten Nachricht von Christus nicht die lehrmäßige Seite der Dinge hervorhebt, sondern sie oft in den Hintergrund rückt, um moralische Wahrheiten zu betonen. Zum Beispiel gibt Lukas im zwölften Kapitel die Lehre des Herrn über sein zweites Kommen wieder (Lk 12,35-40). Beim Studium dieses Abschnitts lassen sich Bibelleser oft vom Wesentlichen ablenken, indem sie herauszufinden versuchen, ob sich der Herr auf die Entrückung oder auf die Erscheinung bezieht, und deshalb verstehen sie oft den Sinn seiner Lehre nicht. Der Herr spricht hier die Notwendigkeit an, dass die Gläubigen in einem rechten moralischen Zustand sind, während sie auf sein Kommen warten, und deshalb spricht Lukas ganz allgemein von der Ankunft des Herrn, ohne sich auf einen der beiden Aspekte zu konzentrieren. Es ließen sich Dutzende von Beispielen anführen, um diese moralische Betonung gegenüber der lehrmäßigen Seite der Dinge zu verdeutlichen. Wenn wir dies bei der Lektüre des Lukasevangeliums berücksichtigen, werden wir den vollen Nutzen aus der Lehre ziehen.
Lukas betont den Dienst des Herrn auf der Ostseite des Jordan
Obwohl sich die vier Evangelisten in den Darstellungen des Lebens und des Dienstes des Herrn teilweise überschneiden, geht jeder von ihnen auf ein anderes Gebiet ein, wo Er im Land Israel wirkte. Matthäus konzentriert sich vor allem auf den Dienst des Herrn in Galiläa (Mt 4,12–15,20; 15,29–16,12; 17,22–18,35), während Markus zwar den Dienst des Herrn in Galiläa erwähnt, aber sein Wirken in den abgelegenen Gebieten um Galiläa herum ausweitet (Mk 6,1–9,27). Johannes hingegen konzentriert sich fast ausschließlich auf den Dienst des Herrn in Judäa. Lukas berichtet über den Dienst des Herrn in Galiläa, betont aber seinen Dienst auf dem Weg nach und von Peräa. Dabei handelt es sich um ein Gebiet auf der Ostseite des Jordan im südlichen Teil des Landes, das als „das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan“ bezeichnet wird (Mt 19,1; Mk 10,1). Matthäus und Markus schreiben nur ein einziges Kapitel über diesen Dienst, während Lukas ihm nicht weniger als zehn Kapitel widmet (Lk 9,51–19,27)! Etwa die Hälfte des Stoffes im Lukasevangelium findet sich nicht in den anderen Evangelien! Das macht sein Evangelium einzigartig. Unnötig zu sagen, dass uns ohne das Evangelium des Lukas viel fehlen würde.
Aus The Gospel of Luke. The Operation of Heavenly Grace Among Men in the Person of the Lord Jesus Christ,
Hamer Bay: Christian Truth Publishing, 2022.
Übersetzung: Stephan Isenberg